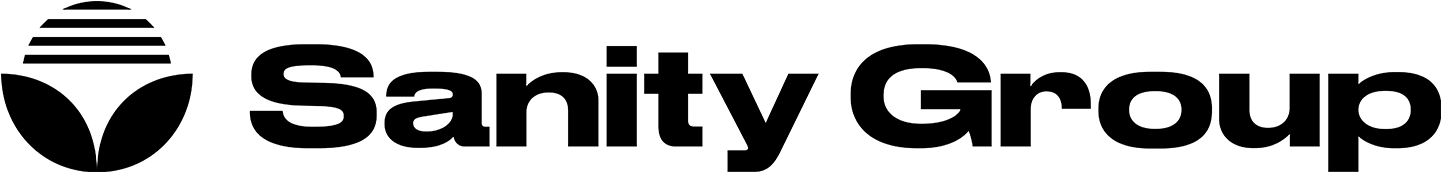…und muss rückgängig gemacht werden“: Das Cannabisgesetz (CanG) ist erst ein Jahr in Kraft, wurde zudem noch nicht vollumfänglich umgesetzt. Eine fundierte Evaluation des Gesetzes ist erst für Herbst 2025 geplant. Außerdem erschwerend: Häufig werden wissenschaftliche Cannabis-Forschungsprojekte mit einer bundesweiten kommerziellen Abgabe von Cannabis verwechselt. Letzteres (die sogenannte Säule II) wurde jedoch nie gesetzlich umgesetzt. Stattdessen ermöglicht die Konsumcannabis-Wissenschafts-Zuständigkeitsverordnung (KCanWV) den rein wissenschaftlichen Umgang mit Konsumcannabis zu Forschungszwecken – mit dem Ziel, belastbare Daten für künftige drogenpolitische Entscheidungen zu liefern.
Wissenschaftliche Studien haben den „Einstiegsdrogen“-Mythos hinreichend widerlegt. Vielmehr geht man davon aus, dass die Kriminalisierung von Cannabis und damit einhergehende Kontakte in den Schwarzmarkt häufig der eigentliche Übergang zu härteren Drogen sind. Was viele außerdem vergessen: Eine Teilnahme an den geplanten Pilotprojekten ist für Jugendliche ausgeschlossen! Ein Nachweis der Volljährigkeit ist für die Studienteilnahme Voraussetzung.
3. „Legale Cannabis-Fachgeschäfte werden zu mehr Konsum führen.“
Studien zu Ländern, in denen Konsumcannabis bereits seit mehreren Jahren legalisiert ist, konnten diese Annahme nicht eindeutig bestätigen. Auch hierzulande soll der bereits bestehende Konsum nicht ausgeweitet, sondern durch qualitätskontrollierte Alternativen zu oftmals verunreinigten Schwarzmarktprodukten weniger gesundheitsschädlich gemacht werden. Erste Ergebnisse eines vergleichbaren Pilotprojekts in der Schweiz deuten darauf hin, dass Studienteilnehmende durch einen legalen Verkauf eher auf den Bezug vom Schwarzmarkt verzichten. Viele reduzieren ihren Konsum sogar – oder wechseln zu weniger gesundheitsschädlichen Konsumformen als Rauchen.
4. „In Fachgeschäften Cannabis kaufen? Bestimmt so einfach wie im Supermarkt.“
Die Pilotprojekte sind streng reguliert und nicht ohne weiteres für die Allgemeinheit zugänglich. Wer Konsumcannabis in einem Fachgeschäft erwerben möchte, muss sich persönlich vor Ort als Studienteilnehmer:in registrieren lassen. Dies setzt die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen voraus, darunter zum Beispiel Volljährigkeit und Ausschluss bestimmter schwerer Erkrankungen. Jeder Kauf wird zur wissenschaftlichen Datenerhebung pseudonymisiert dokumentiert – Einkäufe von nicht registrierten Personen sind damit absolut ausgeschlossen.
5. „Fachgeschäfte werden Cannabistourismus auslösen.“
Deutschland = Niederlande 2.0? Das ist ein Mythos! Die Teilnahme an einer Studie und damit der Einkauf in einem Fachgeschäft sind nur möglich, wenn der Hauptwohnsitz in der jeweiligen Stadt liegt. Das ist bei der Registrierung entsprechend nachzuweisen. So wird sichergestellt, dass keine „Cannabis-Touristen“ aus anderen Regionen oder dem Ausland anreisen, um in den Geschäften einzukaufen.
6. „Man kann in den Fachgeschäften unbegrenzt Cannabis kaufen.“
Nein, die Abgabemengen sind klar begrenzt. Orientiert an den Vorgaben des CanG darf pro Studienteilnehmer:in nur eine bestimmte Menge Cannabis pro Monat erworben werden. Für junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren gelten noch strengere Limits. Um Missbrauch zu verhindern, werden diese Kontingente mithilfe eines personalisierten Teilnehmerausweises kontrolliert – das bedeutet: Bei jedem Einkauf im Geschäft werden die bisherigen Verkäufe überprüft. Ist das monatliche Limit erreicht, kann während des verbleibenden Monats kein THC-haltiges Produkt mehr gekauft werden.
7. „Industriefinanzierte Forschung ist nicht objektiv.“
Geldgeber sind nicht gleich Einflussnehmer: Forschung folgt wissenschaftlichen Standards, nicht wirtschaftlichen Unternehmensinteressen. Industriefinanzierung ist gängige Praxis und bei den geplanten Cannabis-Pilotprojekten auch explizit erlaubt (siehe BMEL). Die wissenschaftliche Leitung der Pilotprojekte agiert komplett unabhängig von den finanzierenden Unternehmen, was mittels Ethikvotum geprüft wird. Sie bestimmt die Forschungsdesigns, analysiert die erhobenen Daten und kommuniziert die Ergebnisse beispielsweise in Form einer Publikation in peer-reviewten Fachjournalen. Zusätzlich werden alle Projekte in öffentlichen Registern dokumentiert.