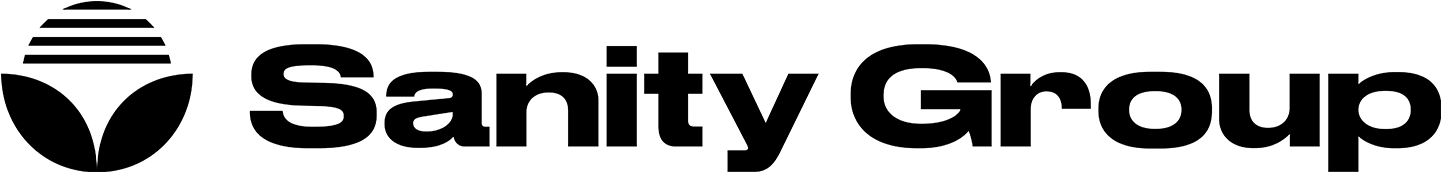Rechtsstatus von Genusscannabis: It’s complicated.
Zwei Jurist:innen, drei Meinungen: Das Sprichwort gilt nicht umsonst als geflügelt. Denn genießen Rechtswissenschaften einerseits den Ruf, extrem exakt und logisch stichhaltig zu arbeiten, so ist gleichermaßen bekannt, dass die konkrete Umsetzung von Paragraphen häufig Auslegungssache ist. Besonders komplex wird ein juristischer Kanon aber, wenn er sich aus verschiedenen, ineinander greifenden Rechtsprechungen zusammensetzt – wie im Falle der Legalisierung von Genusscannabis. Drei Ebenen sind hier zu berücksichtigen: die erste ist das nationale, also deutsche, Recht. Die zweite Ebene ist das europäische Recht. Und die dritte ist schließlich das Völkerrecht. Die Reihenfolge ist an der Stelle zufällig gewählt.
Recht hat immer Vorfahrt – aber welches wann genau?
Zunächst ist also die Frage zu klären: Welches Recht gilt denn nun? Und wann?
Grob gesprochen: Völkerrechtliche Verträge sind von ratifizierenden Staaten zwar grundsätzlich einzuhalten, richten sich jedoch nach dem innerstaatlichen Recht. Sie müssen also vormals in die national geltende Rechtsprechung integriert worden sein, um in letzter Instanz bindend zu sein. Ist das erfolgt, sind die Rechtsprechung und die vollziehende Gewalt an die Gesetze gebunden und diese Verträge nehmen den Rang einfacher Bundesgesetze ein.
Europäisches Recht jedoch sticht nationales Recht. Grundsätzlich wird hier zwischen Primärrecht und Sekundärrecht unterschieden: Das erste meint zum Beispiel Gründungsverträge und gilt als ursprüngliches Recht. Das zweite bezeichnet aus diesem sogenanntes abgeleitetes Recht; beide aber haben im Zweifel das Primat, also Anwendungsvorrang, gegenüber nationalem Recht. Das Völkerrecht wiederum wird sozusagen dazwischen angesiedelt.
Diese intrinsischen Hierarchien und Zusammenhänge zu kennen, ist vonnöten, um die juristische Debatte rund um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland vollständig nachvollziehen zu können – und zu verstehen, warum etwa der beliebte Vergleich mit Ländern wie Kanada oder Uruguay (beides Staaten, die zwar UN-Konventionen unterzeichnet haben, nicht aber supranational organisiert sind) zu kurz greift.
Die Kontroverse: Geht Legalisierung überhaupt?
Im Herbst 2021 verankert die Regierung das Ziel der Legalisierung von Genusscannabis im Koalitionsvertrag. Wenige Monate später, im Juli 2022, zweifelt u.a. der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger das Vorhaben entschieden an. In einer Rede im Bundestag vertritt der junge Arzt die Ansicht, es sei „schlicht unmöglich einerseits alle internationalen und europarechtlichen Vereinbarungen einzuhalten und andererseits gleichzeitig eine rechtskonforme kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften in Deutschland zu ermöglichen“. Damit spricht er ein real existierendes Dilemma an, das zumindest in Teilen schon im Cannabiskontrollgesetzentwurf der Grünen angerissen wurde. Pilsinger befürchtet das Zusteuern auf eine Situation wie in den Niederlanden – mit einer, nach seinem Dafürhalten, „permanenten Beugung europäischen Rechts“ – und beauftragt verschiedene Gutachten beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Diese listen die diversen Hürden auf, ohne jedoch eine konkrete Handlungsempfehlung aufzuzeigen.
Die Ausgangslage: Alle relevanten Abkommen aus Völker- und Europarecht
Bevor auf die verschiedenen juristischen Problemstellungen eingegangen werden kann, ist die Ausgangslage zu klären. Die Bundesrepublik Deutschland hat insgesamt drei hier relevante völkerrechtliche Konventionen ratifiziert:
- Einheitsübereinkommen über Suchstoffe von 1961 (auch in seiner später überarbeiteten Fassung)
In diesen Übereinkommen verpflichten sich die unterzeichnenden Parteien u.a. dazu, jeglichen gewerblichen Handel mit Cannabis zu unterbinden. Als Ausnahme gelten die medizinische oder wissenschaftliche Nutzung. Das letzte Abkommen wurde nicht nur als Einzelstaat, sondern bereits im Verbund mit der Europäischen Union ratifiziert.
Ferner existieren europarechtlich folgende Regelwerke:
Primärrecht:
- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
- Schengener Übereinkommen (SDÜ), das bei der Ausarbeitung 1985 zwar ursprünglich völkerrechtlichen Charakter hatte, am 1.Mai 1999 jedoch ins EU-Recht überführt wurde und somit seitdem als Europäisches Primärrecht gilt: Auch hier verpflichten sich die unterzeichnenden Parteien in Artikel 71 ausdrücklich dazu, „Verkauf, Verschaffung und Abgabe“ von „psychotropen Stoffen aller Art einschließlich Cannabis“ zu unterbinden.
Sekundärrecht:
- Rahmenbeschluss 2004/757/JI von 2004: Der Beschluss nimmt ausdrücklich Bezug auf die UN-Konventionen, übernimmt die dortige Definition von dem, was „Drogen und Grundstoffe“ sind (was Cannabis in Konsequenz miteinschließt) und verpflichtet die Mitgliedsstaaten, das „Gewinnen, Herstellen, Anbieten, Verteilen, Verkaufen, Einführen, Befördern (..) gleichviel zu welchen Bedingungen“ unter Strafe zu stellen – sofern die Tathandlungen „ohne entsprechende Berechtigung“ erfolgen. Die “entsprechende Berechtigung” ist hier jedoch nicht näher definiert. Gleichzeitig notiert Artikel 2: „Die Handlungen nach Absatz 1 fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Rahmenbeschlusses, wenn die Täter sie ausschließlich für ihren persönlichen Konsum im Sinne des nationalen Rechts begangen haben.“ Dies öffnet nach Meinung mancher Expert:innen den Korridor zu einer Möglichkeit der souveränen nationalen Entkriminalisierung von Cannabis.
Wichtig: Aus UN-Konventionen kann ein Land zwar prinzipiell aus- und, z.B. unter geänderten Bedingungen („unter Vorbehalt“), wieder eintreten – aber nur, wenn es diese Konvention auch als Einzelpartei ratifiziert hat. Wurde der Vertrag im Verbund ratifiziert, kann er nicht im Alleingang verlassen werden.
Europarechtliche Rahmen sind grundsätzlich nur durch die Mitgliedsstaaten gemeinschaftlich modifizierbar.
Die Problemstellung: Das Thema ist größer als der Konsum an sich
Hieraus ergeben sich insgesamt somit grundsätzliche Problemstellungen für folgende Bereiche:
1.) Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken (da Genuss nicht medizinisch oder wissenschaftlich definiert ist)
2.) Der Anbau von Cannabis im Inland
3.) Der Import von Cannabis aus Drittstaaten
Eine Legalisierung tangiert unweigerlich weitere (rechtliche) Aspekte der Produktions- und Lieferkette bis hin zur Customer Journey: Wird im Inland angebaut? Oder importiert? Und wenn ja: Von wem wird importiert? Und auf welchem Wege? Verstößt dieses weitere Land seinerseits gegen UN-Konventionen oder Europarecht? Oder wird ein Land zum semi-legalen “Zwischenstopp” für eine Lieferung? Wie verträgt es sich mit den Grundsätzen des europäischen Binnenmarktes, wenn ein Land verkauft, was im anderen verboten ist? Und was ergibt sich aus solchen Situationen für einen möglichen Drogentourismus und das Gleichbehandlungsgesetz für alle EU-Bürger:innen?
Die Lage ist also kompliziert. Selbst wenn nach Meinung mancher Expert:innen das sekundärrechtliche SDÜ einen gewissen Spielraum für nationale Cannabislegalisierung zum persönlichen Genusskonsum zu eröffnen scheint – es stellt sich die Frage, ob der gesamte dazu bestehende juristische Kanon mit all seinen Verflechtungen einfach durch die Brille einer sekundärrechtlichen Grauzone interpretiert werden kann. Und in Summe scheinen weder die völkerrechtlichen Konventionen noch die primärrechtlichen EU-Verträge (in den aktuellen Fassungen) eine barrierefreie deutsche Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken herzugeben.
Allerdings: Rechtsrahmen lassen sich modifizieren. Doch während solch eine Modifikation bei UN-Konventionen etwa durch den oben angedeuteten Austritt und Wiedereintritt unter Vorbehalt erfolgen könnte, und es dafür auch Präzedenzfälle gibt, ist dies bei EU-Recht deutlich komplizierter: Denn hier muss die Union als Ganze einer Gesetzesänderung zustimmen.
Zwar besteht auch unter Jurist:innen Einigkeit darüber, dass eine hochkomplexe rechtliche Situation vorliegt. Anders als der Mediziner Pilsinger halten viele diese Herausforderung jedoch nicht für per se unüberwindbar. Peter Homberg, ein führender deutscher Cannabisrechtler, fasst die Situation wie folgt zusammen: „Der Weg der rechtskonformen Cannabislegalisierung ist beschwerlich, aber nicht unmöglich.“
Verschiedene Auslegungen: Vieles ist möglich – aber nichts davon schnell
Die Debatte zu den jeweils einzelnen Gesetzesartikeln und ihren Feinheiten lupengenau im Detail abzubilden, würde den Rahmen dieses Textes sprengen. Daher seien verschiedene Positionen und Lösungsansätze hier lediglich grob skizziert.
Kai Ambos: Der Wandel ist nötig und überfällig
Am wohl leidenschaftlichsten argumentiert der Professor für Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht und Völkerrecht Kai Ambos. Zuvorderst spricht er sich für die aus seiner Sicht längst überfällige juristische Unterscheidung zwischen Cannabis und harten Drogen aus. Die in den Konventionen vorhandenen und von darauf bezugnehmenden europarechtlichen Gesetzestexten übernommenen Definitionen, sowie die darin verankerte Kriminalisierungspflicht von Cannabis, hält er grundsätzlich für zu undifferenziert. Er verweist darauf, dass bereits bei der Verabschiedung des Übereinkommens von 1988 Uneinigkeit über die Notwendigkeit der Kriminalisierung des Cannabis-Besitzes zum Eigenkonsum bestand. Für ihn relevant ist ferner der enthaltene Verfassungvorbehalt der Konvention von 1988. Den einzelnen Staaten bliebe in seinem Dafürhalten ein erheblicher Spielraum, um erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.
Seiner Ansicht nach lässt sich das Legalisierungsbestreben plausibel mit besserem Gesundheitsschutz der Bevölkerung verargumentieren, der wiederum im AEUV dezidiert als Ziel der europäischen Union definiert wurde. Er ist einer der Juristen, die – sehr vereinfacht gesprochen – in der Formulierung, der Handel „ohne entsprechende Berechtigung“ sei zu unterbinden, eine Möglichkeit sieht: Zwar scheint insgesamt eindeutig, dass der Gesetzgeber unter „entsprechender Berechtigung“ bis dato medizinische und wissenschaftliche Zwecke verstanden wissen wollte – aus Sicht des Professors sind die Möglichkeiten, eine solche Berechtigung national neu zu definieren jedoch potentiell gegeben. Einen Austritt mit Wiedereintritt aus dem Übereinkommen von 1988 mit einem eng formulierten Verfassungsvorbehalt zum Eigenkonsum hält er für denkbar.
Stefan Hombach, Daniel Thym und Robin Hoffmann argumentieren strikt gegen einen nationalen Alleingang. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln warnen sie davor, einen europarechtlichen Präzedenzfall mit ungewissem, aber – für Deutschland sowie die gesamten Legalisierungsbestrebungen – potentiell nachteiligen Ausgang zu schaffen.
Daniel Thym: Recht vs. Realpolitik – Europa muss es wollen
Daniel Thym, Professor für Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz, gesteht Ambos zwar eine plausible Argumentationslinie zu grundsätzlichen „Schlupflöchern“ zu. Allerdings existieren aus seiner Sicht keinerlei Zweifel daran, dass das letzte Wort beim EuGH und der europäischen Rechtsprechung liegen muss. Daher besteht er darauf, dass hier nur gemeinsame europäische Schritte eine belastbare Lösung sein können: So wäre völkerrechtlich ein Austritt Deutschlands aus der Konvention von 1961 zwar möglich, nicht aber ohne Weiteres aus jener von 1988, die im Verbund mit der Europäischen Union als „gemischtes Abkommen“ unterzeichnet wurde.
Aus seiner Sicht können zwar sowohl das SDÜ als auch der Rahmenbeschluss so ausgelegt werden, dass eine Cannabis-Legalisierung erlaubt werden kann – diese muss allerdings im Verbund erfolgen. Auf Verfassungsvorbehalt zu pochen, erscheint ihm insofern kritisch, als dass eine einfache Gesetzesänderung eventuell nicht ohne Weiteres den Anspruch eines verfassungsrechtlichen Unterfangens erheben kann.
Doch auch wenn er juristisch mit Art. 114 AEUV die Möglichkeit einer europaweiten Cannabis-Legalisierung für möglich hält – sofern der Rahmenbeschluss und das SDÜ entsprechend geändert werden würden – realpolitisch hält er dies zum jetzigen Zeitpunkt für utopisch.
Robin Hoffmann: Legalisierung kriminologisch sinnvoll – aber nicht so einfach
Auch Robin Hoffmann, der die Legalisierung aus kriminologischer Sicht befürwortet, sieht das europäische Recht hier als Dreh- und Angelpunkt. Ohne entsprechende europarechtliche Verankerung der Legalisierung ergeben sich für ihn eine ganze Summe an daraus resultierenden Detailproblemstellungen: Angefangen von der Frage des Anbau oder Importen (beides wäre juristisch schwierig), fortgesetzt über die Frage des zu erwartenden innereuropäischen Drogentourismus, bis hin zur nicht vorhandenen Investitionssicherheit von und für Cannabisunternehmer:innen.
Einen Lösungsvorschlag sieht er in einem wissenschaftlichen Pilotversuch mit sämtlichen entsprechenden Auflagen: So könnte einerseits eine Abgabe an Genusskonsument:innen im Einklang mit Völker- und Europarecht gewährleistet werden. Zum Zweiten würde eine valide Datenbasis erhoben, die Grundlage einer künftigen gesamteuropäischen Entscheidung zum Thema sein könnte. So ließe sich nach seinem Dafürhalten das (ansonsten mögliche) Worst-Case-Scenario verhindern, in dem die EU-Kommission oder ein anderer Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art.258 / 259 AEUV gegen Deutschland einleiten.
Peter Homberg: Vor Nachverhandlungen geht gar nichts
Homberg, ein führender Cannabisrechtler, thematisiert seinerseits das Problem des Anbaus und Imports sowohl auf völker- als auch europarechtlicher Ebene: Nach seiner Auslegung führt kein Weg an einer Nachverhandlung der europäischen Verträge vorbei, wenn die Legalisierung von Genusscannabis in Deutschland, sowie der inneneuropäische Handel, auf rechtlich wasserdichtem Boden stehen wollen. Ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof betrachtet er als kaum einzuschätzendes Risiko – bei dem der beklagte Mitgliedstaat aus seiner Sicht beste Chancen hätte, zu unterliegen.
Fazit: Es bleibt spannend
Die juristische Situation ist aufgrund der verschiedenen ineinander verschachtelten Rechtslagen hochkompliziert. Gleichwohl scheint eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken nicht per se undenkbar – sofern sie mit europäischem und UN-Recht in Einklang gebracht wird.
Verschiedene Szenarien werden hier diskutiert: Der Ausstieg aus einer völkerrechtlichen Konvention, die Deutschland als Einzelstaat ratifiziert hat, wäre zwar möglich – würde aber nichts an der Tatsache ändern, dass die Konvention von 1988 als EU-Staatenverbund ratifiziert wurde und somit nicht von einem einzelnen Mitgliedstaat aufgelöst werden kann. Auch könnte sie die Fragen nach Importen aus Drittstaaten nicht zufriedenstellend beantworten und der Verstoß gegen europäisches Recht durch Handel mit Cannabis stünde flugs im Raum. Rechtliche Konsequenzen wären somit denkbar.
Ein gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene scheint eine Möglichkeit, um die Bedingungen für eine Legalisierung zu schaffen. Staaten wie Portugal, Luxemburg oder die Niederlande können in solch einem Bestreben Partner sein. Dieser Weg würde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ob derweil nationale Mittelwege durch die rechtliche Grauzone in Frage kommen, wie sie die Niederlande oder Luxemburg schon beschreiten, ist mithin eine politische Frage, die an dieser Stelle nicht beantwortet werden kann.
Eine weitere gangbare Option sehen viele in der Etablierung von wissenschaftlichen Pilotversuchen zur Legalisierung von Genusscannabis. Voraussetzung hierfür ist allerdings die strikte Einhaltung von klar definierten Standards für wissenschaftliche Forschung. So könnte die im Rahmenbeschluss verankerte gebotene Notwendigkeit einer entsprechenden „Berechtigung“ rechtskonform funktionieren. Die auf diese Weise generierte Datenbasis könnte ferner die Grundlage für eine perspektivische Modifikation der Rechtslage sein.
Um alle Details der völker- wie europarechtlichen Fragen abschließend zu erörtern und Vorschläge für politische Lösungsansätze zu ermitteln, hat die Bundesregierung eigens eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Ergebnisse des Eckpunktepapiers wurden am 26.10.2022 vorgestellt. Derzeit erarbeitet die Bundesregierung auf dieser Basis einen Gesetzesentwurf, der Ende März 2023 vorgelegt werden soll.
Factsheet
Falls du noch mehr Interesse an unseren Factsheets hast findest du hier noch mehr!
Beitragsbild: Unsplash.com